Die sogenannten „digital natives“ wachsen in einer digitalisierten Lebenswelt auf. Völlig selbstverständlich wird über das Internet und soziale Medien kommuniziert, das Smartphone ist der ständige Begleiter in allen Lebenslagen, der Onlineauftritt mindestens ebenso bedeutsam wie das persönliche Auftreten. Doch bei genauerer Betrachtung wird klar: nicht alle „digital natives“ sind vorne mit dabei, wenn es darum geht, ihre digitale Lebenswelt mitzugestalten.
Das Smartphone wird zum Standard
Die Abdeckung der Jugendlichen in Österreich mit Smartphones ist überraschend hoch. Laut Statistik Austria gehen 95% der 16- bis 24-Jährigen mit dem Smartphone online. Zu ähnlichen Ergebnisse kommt die aktuelle Studie des Instituts für Jugendkulturforschung im Auftrag der Arbeiterkammer Wien. Der Laptop spielt dagegen nur im Leben von SchülerInnen in maturaführenden Schulen eine große Rolle (71%). In der Gruppe der “bildungsferneren” Jugendlichen verfügt nur knapp die Hälfte über einen Laptop im Haushalt. Dabei haben die „digital natives“ hohes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse im Umgang mit Computer und Internet. Acht von zehn Jugendlichen geben an, sich „gut“ (56%) und „sehr gut“ (26%) auszukennen. Das Geschlecht, der Ausbildungsweg und auch der Migrationshintergrund scheint dabei keine Rolle zu spielen. Auf dem ersten Klick scheint also alles in Ordnung.
Ein neuer “digital divide“?
Bei genauerer Betrachtung erweist sich das Bild der umfassend kompetenten “digital natives” als Mythos. Innerhalb der Gruppe der “digital natives” ist die Lebenswelt zwar weitgehend digitalisiert, bei der Art der Nutzung und der Gestaltung dieser Lebenswelt zeigen sich aber große Unterschiede. Oder wie die New York Times bereits 2012 treffend formulierte: “Die Zeitverschwendung im Internet ist die neue digitale Spaltung”. Anders ausgedrückt: Nutze ich die neuen digitalen Möglichkeiten aktiv und erweitere meine Möglichkeiten mich auszudrücken, oder konsumiere ich passiv, was andere gestalten? Diese unterschiedliche Nutzung der digitalen Möglichkeiten zeigt sich in vielen Studien und auch in jener unter Wiener Jugendlichen zb. beim Einsatz digitaler Mittel für die Schule und Ausbildung. Je höher der Bildungsabschluss, desto eher werden Lernsoftware, online-Recherche etc. genutzt. Gleichzeitig zeigen sich in allen Teilen der “digital natives” große Lücken bei der Informationsbewertung und der kritischen Auseinandersetzung mit den Anbietern und Inhalten von Online-Quellen.
Die Entwicklung der digitalen Kompetenzen braucht häufige Lerngelegenheiten und kompetente Vorbilder. Dabei fallen die meisten Eltern als “digital immigrants” meist (noch) aus. Damit würde der Schule eine wichtige Rolle zur Vermittlung digitaler Grundkompetenzen zukommen. Aus Sicht der Wiener Jugendlichen hätte sie dafür auch die besten Voraussetzungen, da den LehrerInnen durchaus hohe Kompetenzen zugetraut werden.
Gleichzeitig zeigt sich ein ernüchterndes Bild bei der Nutzung von Internet und Computer im Unterricht. Ganz nach dem Matthäus-Prinzip, arbeiten jene mehr mit dem Computer, die ohnehin schon höhere Kompetenzen ausweisen. Ebenso nützen vor allem maturaführende Schulen häufiger die wertvolle Methode des “Bring your own Devices” bei der Jugendliche ihre Smartphones mit pädagogischer Unterstützung als Lern- und Arbeitsmittel einzusetzen lernen. Die Spaltung vertieft sich. In der medialen Diskussion rücken die Kosten für die digitale Bildung immer stärker in den Fokus. In der aktuellen Schulkosten-Studie der Arbeiterkammer zeigt sich eine hohe Belastung durch den Ankauf von Hardware, sowie durch zusätzliche Lernsoftware und digitalen Lernmaterialien an höhere Schulen. Besonders die Anschaffung teurer Spezialgeräte für graphische oder technische Schulen ist für viele Erziehungsberechtigte nur schwer oder gar nicht finanzierbar. Viele Staaten haben die Notwendigkeit umfassender digitaler Bildung erkannt, darunter Deutschland und die USA. Auch in Österreich braucht es eine Auseinandersetzung über einen gerechten Zugang zur digitalen Bildung. Viele Grundlagen dafür, wie Kompetenzmodelle und Leuchtturmprojekte wurden bereits umgesetzt. Damit die digitale Spaltung verhindert werden kann, braucht es aber ambitionierte, flächendeckende Maßnahmen: Und zu guter Letzt ein wichtiger Punkt, der als Ergebnis der laufenden Digitalisierung von Bildung immer bedeutsamer werden wird: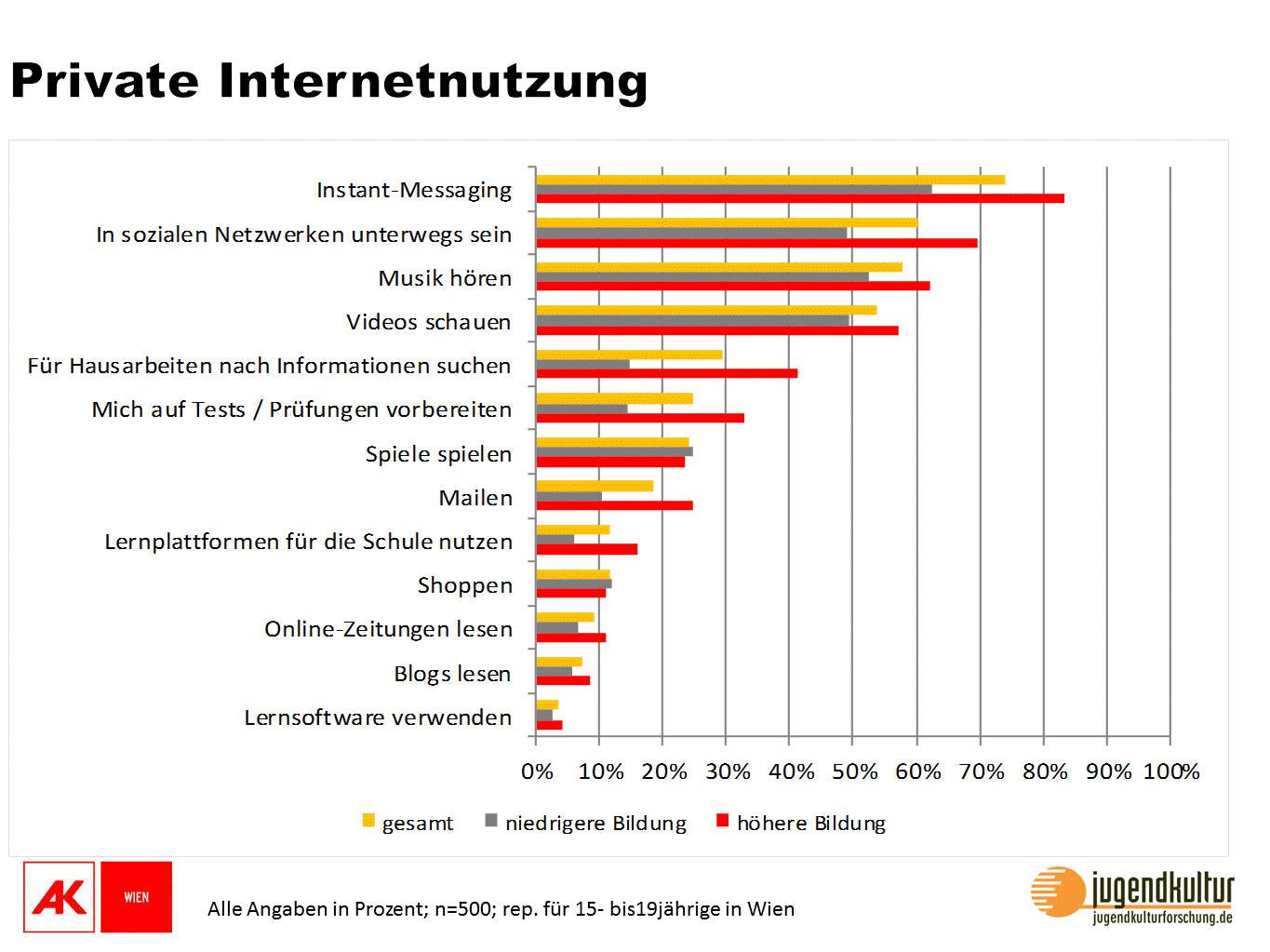
Der “digital divide” in der Schule
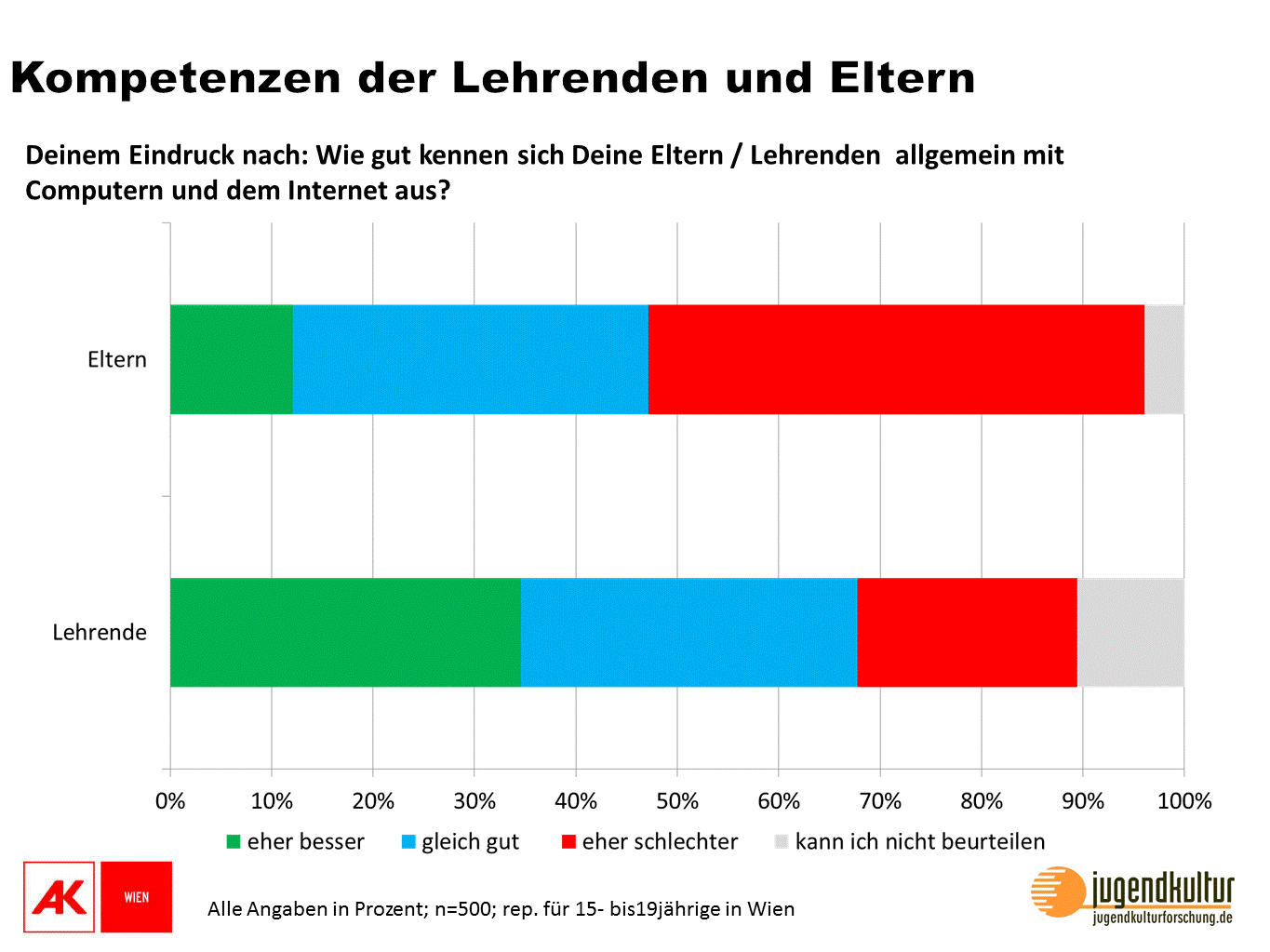
Wer trägt die Kosten
Den “digital divide” schließen
